|
|
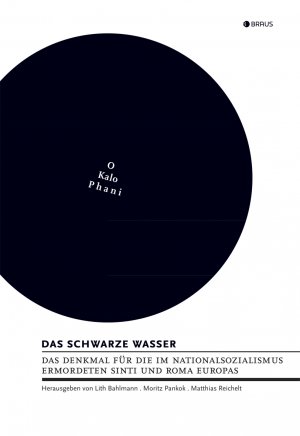 Die schön gestaltete Publikation dokumentiert in verschiedenen historischen, einordnenden Beiträgen sowie künstlerischen und photographischen Interventionen den Prozess der Errichtung des Denkmals in Berlin, in dessen Mittelpunkt das schwarze Wasser liegt. Vom Beschluss des deutschen Bundestages 1992 bis zur Eröffnung 2012 werden 20 Jahre langwieriger und unwürdiger Diskussionen dargestellt: zunächst wird die historische Einordung des Genozids an Roma und Sinti im Nationalsozialismus in der Einleitung von Romani Rose und im Überblick sowie der Chronologie des Völkermordes von Silvio Peritore und Frank Reuter wiedergegeben; in "Beschränkungen des Gedenkens" spannt Wolfgang Wippermann von dem skandalösen Urteil des Bundesgerichtshof gegen Ansprüche auf Entschädigung für die Überlebenden in den 50er Jahren - einhergehend mit der Leugnung des Völkermordes in der deutschen Öffentlichkeit - den Bogen bis zur Ablehnung durch die Initiatoren des Holocaustdenkmals in Berlin einen gemeinsamen Gedenkort an den nationalsozialistischen Völkermord zu errichten. Dani Karavan, der das Denkmal künstlerisch und planerisch konzipierte, berichtet lapidar- und umso erschütternder - über die Verzögerungen bei der Errichtung des Denkmals: die unsägliche Diskussion über die Fremdbezeichnung "Zigeuner" anstatt Sinti und Roma für das Denkmal und auf den Texttafeln und über den Streit um die Opferzahlen. Dies wurde von der Öffentlichkeit gerne breitgetreten um von bautechnischen und anderen Fehlleistungen bei der fachgerechten Umsetzung des Mahnmals abzulenken. In seinem Beitrag "Hommage an die im Holocaust ermordeten Sinti und Roma, Berlin, Deutschland" schreibt Dani Karavan, dass der Streit zwischen ihm und der betreuenden Senatsbehörde zum "Alptraum" wurde, bis der Staatskulturminister Bernd Naumann entschied den örtlichen Architekten und den Senat vom Projekt abzuziehen. Auch erläutert Dani Karavan das künstlerisch-ortsbezogenen Konzept des Denkmals. Tímea Junghans und Delaine Le Bas beschreiben jeweils in einem Beitrag ihre künstlerische Intervention auf der Baustelle des Denkmals und ihre Reflektionen zu den zermürbenden Verzögerungen. Delaine Le Bas schreibt: "Für mich persönlich war es erschütternd zu sehen, dass jedes andere Denkmal, das ich auf dem Weg dahin passierte sauber und gepflegt war, während dieses Denkmal symbolisch jenen Zustand verkörperte, den man auch unserem Volk zuschreibt: dreckig, unbeachtet, eingezäunt …". Symptomatisch ist, dass der Berliner Senat und die Deutsche Bahn planen genau diesen Baustellen-Zustand wieder herzustellen, durch den Bau eines S-Bahntunnels unter dem Mahnmal. Der eindrückliche Wunsch im Fazit von Wolfgang Wippermann, dass die "erreichte Eröffnung des `Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma Europas` … den Diskussionen ein Ende setzen, den Porajmos anerkennen und dem Gedenken an die Opfer endlich einen angemessenen Ort und Raum im öffentlichen Bewusstsein …" geben würde, hat sich zwölf Jahre nach der Fertigstellung und feierlicher Einweihung leider nicht erfüllt. 2025 wird von Berliner Behörden und der Deutschen Bahn zerstörerische Hand an das Denkmal gelegt. 22.04.2025, © www.foerdervereinroma.de siehe auch: Gloss-ip: Endstation Rampe. Wie die Deutsche Bahn das Gedenken untertunnelt, 25.03.2025 |